2025: Das Jahr, in dem ich bei mir ankam
Mein persönlicher Jahresrückblog 2025

Ich sitze in meiner Wohnung in Worpswede. Draußen ist es still. Nicht die Stille einer Stadt in der Nacht, sondern diese andere. Die, die nicht leer ist. Die, die atmet.
Durch das Fenster sehe ich die Bäume. Kahl. Aber nicht tot. Sie stehen einfach da. Ohne Rechtfertigung.
Ich sitze nicht hier, um Bilanz zu ziehen. Kein Ritual. Kein besonderer Moment. Das Jahr ist einfach zu Ende. Und offen gesagt wüsste ich auch gar nicht, womit ich anfangen sollte.
Ein Gedanke taucht auf.
Leise, fast beiläufig: Wann habe ich eigentlich aufgehört zu kämpfen?
Nicht dramatisch. Nicht laut. Einfach so.
Eines Tages im Jahr 2025. Da bin ich sicher.
Es ist Ende Dezember.
Zeit für Jahresrückblicke. Für Listen mit Erfolgen. Zahlen. Reichweiten.
„Was ich alles erreicht habe.
Dieses Bedürfnis, ein Jahr erklärbar zu machen. Verwertbar. Vorzeigbar.
Das hier wird anders.
Nicht aus Trotz. Sondern aus Klarheit.
2025 war für mich kein Jahr der Erfolge. Es war ein Jahr der Reibung.
Und des Ankommens.
Was vor 2025 war
Jahrelang habe ich versucht, es richtig zu machen.
PrimeTime Ü50.
Ein Projekt für Menschen über 50.
Klang sinnvoll. Fühlte sich anfangs richtig an.
War es nicht.
Barfuß im Kopf.
Ein Offline-Projekt. Mit Bewegung, Spaß und guter Laune.
Gut gemeint. Aber noch nicht dran.
Und dann Social Media.
Instagram. Facebook. TikTok.
Alle sagten:
Du musst sichtbar sein.
Du musst Reichweite aufbauen.
Du musst regelmäßig posten.
Du musst den Algorithmus verstehen.
Ich habe es versucht.
Ich habe Posts geschrieben. Bilder hochgeladen. Hashtags recherchiert. Und jeden Tag dabei gespürt: Das ist nicht meins.
Nicht, weil ich zu dumm bin. Nicht, weil ich zu faul bin.
Sondern, weil es nicht zu mir passt.
Social Media, dem Algorithmus, folgend, erschöpft mich. Ständige Präsenz widerspricht allem, wofür ich stehe. Performance fühlt sich falsch an.
Aber ich dachte:
Vielleicht muss ich mich eben anpassen.
Vielleicht funktioniert Business nur so.
Bis ich 2025 verstanden habe: Nein. Muss es nicht.
Was 2025 sichtbar gemacht hat
2025 hat nichts Neues erfunden. Es hat nur Dinge freigelegt, die vorher schon da waren.
Insbesondere diesen Maßstab, der überall mitschwingt. Unaufdringlich. Selbstverständlich. Kaum je ausgesprochen.
Aber ständig wirksam.
Tempo gilt als Normalzustand.
Sichtbarkeit als Beweis von Relevanz.
Wachstum als Zeichen von Ernsthaftigkeit.
Nicht nur im Business. Überall.
Wer langsamer baut, gilt als zögerlich.
Wer nicht ständig sendet, ist unsichtbar zwischen all den „Lauten“.
Wer kein klares „Mehr“ anstrebt, ist jemand, der es nicht wirklich will.
Das ist kein offener Druck.
Niemand zwingt dich. Niemand sagt es laut.
Und genau das macht ihn so wirksam.
Ich habe gemerkt, wie oft ich innerlich schon reagiert habe, bevor überhaupt etwas gefordert wurde.
Wie schnell ich angefangen habe, mich zu erklären. Zu relativieren. Vorwegzunehmen, was andere vielleicht denken könnten.
Nicht, weil jemand mich dazu gezwungen hätte. Sondern weil der Rahmen so gebaut ist, dass Abweichung automatisch erklärungsbedürftig wird.
Die eigentliche Arbeit war nicht das Tun. Es war das ständige Mitdenken des Maßstabs.
2025 hat mir gezeigt, wie viel Energie genau dort verloren geht.
Nicht im Machen. Sondern im inneren Abgleichen mit einem System, das nur bestimmte Formen kennt.
Das sichtbar zu sehen, war unbequem. Aber notwendig.
Und mit diesem Sehen veränderte sich etwas.
Nicht emotional. Sondern strukturell.
Ich sehe plötzlich klarer, wie Bewertungen entstehen.
Wie Abweichung fast automatisch gelesen wird.
Nicht als Variante.
Sondern als etwas, das erklärt werden muss.
- Wer langsamer ist, gilt als zögerlich.
- Wer schneller ist, als rücksichtslos.
- Wer still ist, als desinteressiert.
- Wer deutlich ist, als anstrengend.
- Wer bleibt, als bequem.
- Und wer geht, als unzuverlässig.
Das Muster ist immer dasselbe.
Nicht das Verhalten ist das Problem.
Sondern der Maßstab, an dem es gemessen wird.
Einmal gesehen, für immer im Blick.
Nicht, weil ich mich dagegen auflehne.
Sondern weil ich aufhöre, mich darin zu verfangen.
Es geht mir nicht darum, neue Ideale zu setzen.
Weder leise noch laut. Weder langsam noch schnell.
Es geht darum, diese Logik zu erkennen.
Und mich ihr an bestimmten Stellen zu entziehen.
Nicht demonstrativ.
Nicht erklärend.
Sondern einfach, indem ich aufhöre, mich selbst ständig einzuordnen.
Die beste Entscheidung, die ich getroffen habe
Im Sommer habe ich dann eine Entscheidung getroffen.
Ich habe PrimeTime Ü50 in den Archiv-Ordner gelegt.
Das Projekt Barfuß im Kopf pausiert.
Diverse Social-Media-Kanäle stillgelegt.
Nicht aus Resignation. Aus Klarheit.
Diese Projekte waren gut gemeint. Aber sie waren nicht ich. Sie waren Versuche, ein Business zu bauen, wie „man“ es eben macht.
Und ich habe verstanden: Ich kann das nicht.
Nicht, weil ich unfähig bin. Sondern weil es mich erschöpft, etwas zu sein, das ich nicht bin.
Das war die wichtigste Entscheidung des Jahres.
Nicht das Anfangen von etwas Neuem. Sondern das Aufhören mit etwas, das nie wirklich gepasst hat.
Das loszulassen war kein Befreiungsschlag. Eher ein stilles Aufhören.
Manches davon habe ich nicht aus Klarheit losgelassen, sondern aus Müdigkeit. Und das war in Ordnung.
Der Preis des Aufhörens
Das Aufhören hatte einen Preis.
Keinen dramatischen.
Keinen, den man sofort benennen könnte.
Es gab Momente, in denen sich das Loslassen nicht wie Klarheit angefühlt hat, sondern wie Rückzug. Wie ein leises Verschwinden aus Räumen, in denen andere sichtbar bleiben.
Ich habe gemerkt, wie schnell Aufhören mit Scheitern verwechselt wird.
Auch von mir selbst.
Nicht laut. Eher in diesen kurzen Gedanken:
Vielleicht hätte ich doch noch…
Vielleicht war ich zu früh müde.
Vielleicht hätte ich es nur anders angehen müssen.
Manches davon war kein Zweifel an der Entscheidung, sondern an mir.
Ich habe Erwartungen enttäuscht.
Nicht unbedingt ausgesprochene. Aber solche, die mitschwingen, wenn man etwas anfängt und dann nicht so weitermacht, wie es vorgesehen ist.
Dieses Aufhören hatte nichts Heroisches. Es war nicht mutig. Es war notwendig.
Und ja: Es hat etwas gekostet. Anschluss. Erklärbarkeit. Das beruhigende Gefühl, „auf dem richtigen Weg“ zu sein.
Aber es hat mir etwas zurückgegeben, das ich vorher ständig verhandelt habe:
Ruhe im eigenen Maßstab.
Was gekommen ist
Ich habe verstanden: „Anders richtig“ ist kein Konzept.
Es ist keine Marke.
Es ist keine Positionierung.
Es ist, wer ich bin.
Die Haltung, die ich vermitteln will, ist die Haltung, aus der ich lebe.
Anders ist nicht falsch. Anders ist einfach anders.
Das gilt für meine Zielgruppe. Und es gilt für mich.
Und plötzlich wurde alles klarer.
Ich habe angefangen zu schreiben. Nicht für Reichweite. Nicht für Engagement. Sondern weil ich etwas zu sagen habe.
Ich habe Substack gestartet. Artikel geschrieben.
Über Wildnispädagogik. Über Logotherapie. Über das Zusammenspiel von beidem.
Und über Themen, die mir wichtig sind.
Keiner davon hat viele Leser erreicht. Aber jeder Einzelne ist echt.
Und dann habe ich ein Workbook geschrieben.
122 Seiten. „Allein?“ Ja, bitte!”
Viele Nächte habe ich daran gearbeitet.
Abends nach der Arbeit im öffentlichen Dienst. Am Wochenende. Montags und dienstags, wenn ich Zeit hatte.
Seite für Seite.
Es ist kein perfektes Buch. Aber es ist meins.
Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein ganz eigenes Produkt fertiggestellt.
Nicht eines, das der „Markt“ vielleicht brauchen könnte.
Ich habe eine Website gebaut. Meinen ersten eigenen Shop. Ein Fundament.
Nicht laut. Nicht spektakulär. Aber echt.
Das war das erste Mal, dass ich wirklich nur für mich gearbeitet habe.
Das erste Mal, dass ich nicht parallel drei Projekte versucht habe.
Das erste Mal, dass ich gesagt habe: Nur das. Nichts anderes.
Das Künstlerdorf Worpswede
Im Juni bin ich nach Worpswede gezogen. Und es fühlt sich richtig an.
Dieser Ort ist (im Moment) perfekt für mich.
Er ist still, wenn ich es still haben will.
An manchen Tagen vergeht Zeit, ohne dass ich einem Menschen begegne.
Nicht, weil es hier leer wäre, sondern weil ich mir meine Wege so wähle.
Ich suche die stillen Ecken des Ortes auf, bleibe stehen, wo andere vorbeigehen,
verweile am Fenster und widme mich dem Schreiben.
Diese einfachen Tätigkeiten genügen mir vollkommen.
Aber Worpswede kann auch lebendig. Wenn ich Lust auf Menschen habe, dann gibt es Cafés. Kleine Läden. Galerien.
Touristen, die kommen und gehen. Leben, das nicht bleibt, aber da ist, wenn ich es will.
Die Wohnung ist wie für mich gemacht: drei Zimmer im Erdgeschoss, mit nicht einer, sondern gleich zwei Terrassen – als könnte ich plötzlich anfangen, Terrassenpartys im Schichtbetrieb zu veranstalten.
Platz ist reichlich vorhanden, gerade so, dass ich mich nicht verlaufe, aber auch nicht das Gefühl habe, in einem Schuhkarton zu wohnen.
Perfekt ausbalanciert zwischen „Ich kann atmen“ und „Ich brauche keinen Stadtplan, um die Küche zu finden“.
Die Nachbarn lassen mich sein. Sie grüßen, wenn wir uns sehen. Aber sie erwarten nichts. Keine Erklärung. Keine Rechtfertigung. Keine Small-Talk-Pflicht.
Hier kann ich meine Individualität leben, ohne mich erklären zu müssen.
Das klingt vielleicht klein. Aber für mich ist es riesig.
Meine Enkel
Zwei kleine Mädchen.
Wenn ich sie sehe, merke ich: Die Welt, in die sie wachsen, braucht Menschen, die anders denken.
Die nicht alles mitmachen.
Die nicht jede Norm übernehmen.
Die sich nicht verbiegen, nur weil es von ihnen erwartet wird.
Sie haben meine Sicht auf die Zukunft verändert.
Nicht dramatisch. Aber spürbar.

Es geht nicht mehr nur um mich. Es geht nicht nur um mein Business. Es geht um das, was ich weitergebe.
Früher habe ich über die Zukunft nachgedacht und mich gefragt: Was wird aus mir?
Jetzt denke ich: Was für eine Welt hinterlasse ich?
Das ist ein anderer Maßstab. Ein tieferer.
Wofür ich dankbar bin
Ich bin dankbar für Worpswede. Für einen Ort, der mich sein lässt.
Ich bin dankbar für meine Enkel. Für die Erinnerung daran, dass es um mehr geht.
Ich bin dankbar für meine finanzielle Sicherheit. Dafür, dass ich im öffentlichen Dienst arbeite. Dass ich mit 55 noch ausreichend Zeit habe. Dass ich langsam bauen kann, ohne Existenzdruck.
Das ist ein Privileg. Und ich nehme es an.
Ich bin dankbar für die Nachbarn, die mich nicht kommentieren. Für die Stille draußen. Für die Bäume, die einfach stehen.
Und ich bin dankbar für die Müdigkeit, die mich aufhören ließ.
Ohne sie hätte ich vielleicht weiter gekämpft.
Weiter versucht, in einen Rahmen zu passen, der nie für mich gedacht war.
Was nicht kam
Es gab noch keinen echten Verkauf.
Das steht hier, weil es wahr ist. Und weil ich es nicht beschönigen will.
Ich habe monatelang gearbeitet. Geschrieben. Gebaut. Veröffentlicht.
122 Seiten Workbook. Eine Website. Ein Shop mit wenigen PDFs. Blogartikel.
Und niemand hat gekauft.

Null Verkäufe. Das tut weh. Natürlich tut das weh.
Es gibt Momente, in denen ich zweifle. In denen ich mich frage, ob das alles Sinn ergibt. In denen ich mich frage, ob ich nur zu langsam bin. Zu leise. Zu anders.
Ob der Markt vielleicht doch recht hat.
Ob ich vielleicht doch sichtbarer sein müsste.
Ob ich vielleicht doch etwas falsch mache.
Aber dann erinnere ich mich: Der Weg ist richtig.
Die Haltung ist richtig.
Das, was ich tue, ist richtig.
Es braucht nur Zeit.
Und Zeit ist etwas, das ich habe.
Ich bin 56. Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Ich habe keine großen finanziellen Sorgen.
Ich kann langsam bauen. Ich kann geduldig sein. Ich muss niemandem beweisen, dass es schnell funktioniert.
Das ist ein Privileg. Und ich nehme es an.
Was ich über mich gelernt habe
Ich habe gelernt, dass ich nicht für Social Media gemacht bin.
Nicht, weil ich es nicht kann. Sondern weil es mich erschöpft, ohne etwas zurückzugeben.
Ich habe gelernt, dass langsam Bauen meine Art ist.
Nicht aus Faulheit. Sondern aus Respekt vor dem, was trägt.
Ich habe gelernt, dass Anpassung mich mehr kostet als Abgrenzung.
Früher dachte ich: Ich muss mich anpassen, um dazuzugehören.
Jetzt weiß ich: Ich muss mich abgrenzen, um bei mir zu bleiben.
Ich habe gelernt, dass Klarheit wichtiger ist als Anschlussfähigkeit.
Dass Gedanken nicht ausformuliert werden müssen.
Dass Entscheidungen nicht abgerundet werden müssen.
Dass nicht alles verstanden werden muss, um gültig zu sein.
Und ich habe gelernt, dass Müdigkeit die ehrlichste Form von Klarheit ist.

Manchmal hört man nicht auf, weil man es verstanden hat. Sondern weil man keine Kraft mehr hat, weiterzumachen.
Und das ist in Ordnung.
2025 in Zahlen
- 122 Seiten Workbook.
- 9 Blogartikel
- 6 Monate in Worpswede
- 2 pausierte Projekte
- 1 veröffentlichte Website
- 1 Shop
- 0 Verkäufe
- 999 Ideen für „Anders richtig“ im Kopf
- 1 Gefühl tiefer Zufriedenheit
Das sind keine beeindruckenden Zahlen. Aber es sind meine.
Was geblieben ist
Nicht alles, was leiser geworden ist, ist verschwunden. Manches ist nur deutlicher zu sehen.
Geblieben ist diese Klarheit, die nicht nach vorn drängt. Kein Plan. Kein Ziel.
Kein „Jetzt aber“.
Sondern ein ruhiges Wissen darum, was passt und was nicht mehr verhandelt wird.
Geblieben ist ein anderes Verhältnis zu Zeit.
Dass Dinge tragen dürfen, auch wenn sie langsam wachsen.
Dass Tiefe nicht sichtbar sein muss, um wirksam zu sein.
Dass Beständigkeit nichts mit Dauerpräsenz zu tun hat.
Geblieben ist auch die Bereitschaft, Dinge stehen zu lassen.
Gedanken nicht auszuerklären. Entscheidungen nicht abzurunden, damit sie anschlussfähig wirken.
Nicht aus Sturheit. Sondern aus Respekt vor dem, was klar ist.
Was ebenfalls geblieben ist, ist ein anderes Körpergefühl.
Weniger Spannung. Weniger inneres Vorwegnehmen.
Nicht entspannt im Sinne von leicht. Sondern ruhiger im Sinne von nicht mehr ständig auf Empfang.
Das ist kein Zustand, den man festhält. Es ist eher eine Haltung, zu der man zurückkehrt.
Und vielleicht ist genau das geblieben: die Erlaubnis, nichts beschleunigen zu müssen.
Nicht das Denken. Nicht das Arbeiten. Und schon gar nicht sich selbst.
Was ich 2025 zurücklasse
Ich lasse diese ständige Bereitschaft zurück, mich erklären zu müssen. Nicht demonstrativ. Nicht trotzig.
Einfach, indem ich es nicht mehr tue.
Ich lasse die Idee zurück, dass Dinge nur dann gültig sind, wenn sie anschlussfähig sind. Wenn sie verstanden werden. Wenn sie in bestehende Kategorien passen.
Manches muss nicht vermittelt werden. Manches darf unübersetzt bleiben.
Ich lasse auch den Reflex zurück, Tempo mit Ernsthaftigkeit zu verwechseln.
Diese innere Stimme, die fragt, ob es nicht schneller gehen müsste. Ob langsames Bauen nicht ein Zeichen von Zögern ist. Ob Ruhe nicht eigentlich Stillstand bedeutet.
Das ist kein Gedanke, den man einmal entscheidet und dann ist er weg. Er taucht wieder auf. Aber er bestimmt nicht mehr.
Zurück bleibt auch diese Erwartung, dass ein Business eine bestimmte Form haben muss, um als solches zu gelten. Sichtbar.
Skalierbar. Wachsend. Immer ein wenig lauter als nötig.
Ich lasse sie da, wo sie herkommt. In einem System, das andere Kriterien braucht als ich.
Und ich lasse die Vorstellung zurück, dass Klarheit immer erklärbar sein muss.
Dass ein inneres Nein eine Begründung braucht.
Dass man nur dann ernst genommen wird, wenn man sich ausliefert.
2025 war das Jahr, in dem ich gemerkt habe, dass Abgrenzung nichts mit Härte zu tun hat. Sondern mit Genauigkeit.
Nicht alles, was man zurücklässt, verschwindet. Aber es verliert seinen Anspruch.
Ausblick auf 2026
2026 wird kein Jahr des Aufholens. Kein Jahr der Beschleunigung.
Kein Jahr, in dem ich versuche, etwas größer zu machen, nur damit es ernster wirkt.
Ich gehe nicht mit Plänen ins neue Jahr, sondern mit Grenzen.
Mit einer klareren Vorstellung davon, wo ich mich nicht mehr einordne. Und wo ich mich nicht mehr erklären werde.
Ich werde weiter langsam bauen.
Nicht als Haltung gegen etwas, sondern als Konsequenz aus dem, was sich bewährt hat.
Tiefe vor Reichweite.
Stimmigkeit vor Taktung.
Klarheit vor Anschlussfähigkeit.
Ich werde Texte schreiben, die stehen bleiben dürfen.
Auch wenn sie nicht geteilt werden. Auch wenn sie niemanden mitnehmen.
Auch wenn sie keinen nächsten Schritt anbieten.
Ich werde vielleicht noch mehr Artikel auf Substack veröffentlichen.
Vielleicht ein zweites Workbook schreiben.
Vielleicht erste Gespräche führen, mein Coaching offline vorantreiben.
Vielleicht werde ich neue Ideen in die Tat umsetzen.
Ich weiß es nicht genau.

Was ich weiß:Ich werde nicht schneller werden.
Ich werde nicht lauter werden.
Ich werde nicht versuchen, etwas zu sein, das ich nicht bin.
Ich weiß nicht, ob das der einfachere Weg ist. Aber es ist der, bei dem ich mir nicht selbst im Weg stehe.
2026 muss nichts beweisen. Und ich auch nicht.
Ich schaue nicht mit Hoffnung auf das neue Jahr. Aber mit Ruhe.
Nicht, weil alles geklärt wäre. Sondern weil der Maßstab klarer ist.
Und das reicht.
Bleib bei dir.
Davis
Falls du dich hier wiedererkennst
Vielleicht, weil du auch versuchst, ein Business anders zu bauen. Vielleicht, weil du auch müde bist vom ständigen Erklären. Vielleicht, weil du auch merkst, dass der gängige Maßstab nicht passt.
Dann bist du hier richtig.
Ich schreibe weiter auf Substack.
Über Anderssein. Über Maßstäbe. Über das, was wirkt, wenn man nicht mehr kämpft.
Und wenn du neugierig bist auf mein Workbook „Allein?“ Ja, bitte! Hier findest du es.
Nicht als Anleitung. Nicht als Lösung. Sondern als Begleitung für Menschen, die sich nicht mehr verbiegen wollen.
Wenn dir einfach nur gefällt, was ich mache:
👉 Hier kannst du mir einen symbolischen Kaffee spendieren.
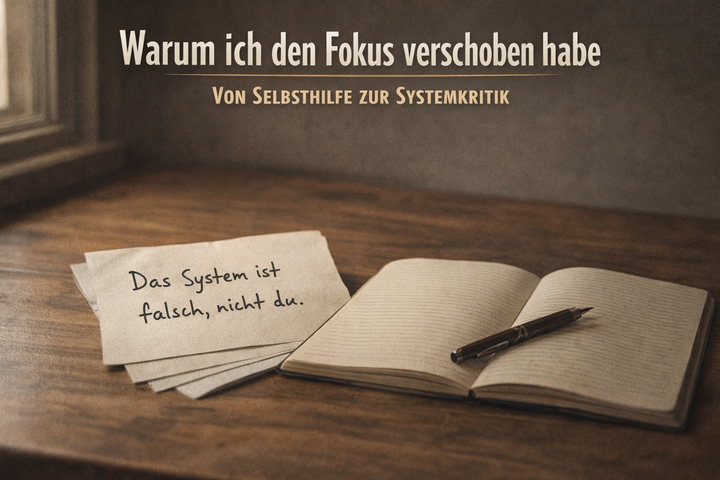

Comments ()